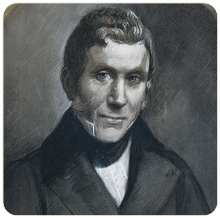Deutschlandfunk Kultur – Ein empfindsamer Patriarch und liberaler Patriot
Samstag 10 Aug 2019
56 Jahre lang hat der Hamburger Jurist Ferdinand Beneke Tagebuch geschrieben und 5000 Seiten gefüllt. Sie zeigen einen persönlichen Blick auf die Zeit von französischer Revolution, Napoleon und Vormärz. Nun sind die Bände von 1802 bis 1810 erschienen.
Äußerlich wirkt es selbst für fleißige Leser wie eine Zumutung: 3.904 Seiten, verteilt auf acht dicke Bände, umfasst der mittlere Teil der Tagebücher von Ferdinand Beneke. Der Hamburger Jurist und politisch engagierte Zeitgenosse war ein überzeugter Republikaner, und seine Aufzeichnungen lösen im Leser einen Sog aus.
„8. Mai 1809, Mondtag. Ein höchst verdrießlicher Tag – so ein verdammter ExtraTag zum Hängen und Todtschießen, wie er im menschlichen Leben nicht durch große Unglücksfälle, sondern durch ein beynahe absichtliches Zusammentreffen vieler kleiner Neckereyen hervorgebracht wird, die Einem dann wie ein PlatzRegen die Gemüthsbekleidung durchnäßen und den SeelenSchnupfen einflößen.“
Nachdem 2012 bereits die ersten Tagebücher von 1792 bis 1801 publiziert worden sind (und 2016 die Zeit der Befreiungskriege 1811 bis 1816 folgte), hat der Wallstein-Verlag nun das fehlende Mittelstück nachgeliefert: Es ist ein Lebensabschnitt, in dem bei Ferdinand Beneke eine herzzerreißende, fast wertherhafte Dreiecks-Liebesgeschichte endet, er aber kurze Zeit später die Frau seines Lebens kennenlernt und heiratet. Politisch und wirtschaftlich geht es auf und ab – Napoleons Kontinentalsperre schadet der Freien Hansestadt Hamburg ebenso wie das wechselnde Kriegsgeschehen jener Tage, auch wenn es sich nicht immer in unmittelbarer Nähe zuträgt.
Besondere Menschenpflichten unter Nachbarn
Zudem ist der Jurist Beneke in eigenen Angelegenheiten kein guter Geschäftsmann, weil ihn die Grundsätze der Aufklärung zur Philanthropie verpflichten, was er – im Gegensatz zu vielen Kaufleuten der Stadt – sehr ernst nimmt. So schreibt er im Oktober 1804:
„Nun giebts nach meiner Meinung unter Nachbaren besondre nähere MenschenPflichten. Die es leugnen, berufen sich auf die allgemeine Humanität. Aber denen traue ich gar nicht. Die sich so vor den besondern praktischen Verhältnißen in concreto scheuen, bey denen ist die allgemeine theoretische MenschenLiebe ein seelenloses abstractum und ein HeuchlerMantel. Die lieben die Menschen nur immer in ihrer Einbildung. Sobald sie einen wirklich vor sich stehen haben, so sehen sie nur seine Mängel, um ihn nur nicht lieben, d.h. ihm nur nicht helfen zu müßen. Endliche Wesen sind wir ja und immer an Raum und Zeit, an Ort und Zahl gebunden. Wer seinen Nachbar liebt, weil er Nachbar ist, der ist sicher ein beßerer Menschenfreund und ein wahrerer Mensch, als die Quintessenz der Menschentümlichkeit aller ausgepreßten Kosmopoliten und sogenannten Philanthropen zusammen ergiebt.“ (Florian Felix Weyh)
Chronik eines Lebens
Ferdinand Beneke hat kein privates Tagebuch geschrieben, sondern die Chronik eines Lebens. Außenwelt und Innenwelt, Politisches und Privates halten sich die Waage. So pedantisch der Hamburger Jurist seine Korrespondenzen, Besuche und Spaziergänge auflistet, so witzig und ausschweifend vermag er zu erzählen. Nur selten vermerkt er: „Abends unter uns.“
Ferdinand Beneke führt ein ausgesprochen reges social life, und in seinem Tagebuch beschreibt er die Hamburger Gesellschaft mit spitzer Feder: „Kopf und Herz sind bey ihm trefflich, aber an Laune fehlts ihm ganz.“ Der Stil verrät, dass der Chronist beim Schreiben an fremde Leserinnen und Leser gedacht hat. Über einen missliebigen Tischgenossen beispielsweise ergießt er eine ganze Kaskade von Adjektiven: „Aber ich sah doch tiefer hinein in den eitelen, egoistischen, engherzigen, verschwenderischen, pralerischen, raufmauligen Husaren.“
Ein Tagebuch mit romanhaften Zügen
Oft hat dieses Tagebuch romanhafte Züge. Dann wird aus dem Tagebuchschreiber ein Ich-Erzähler, der alles daransetzt, seine Leser zu unterhalten. Der Autor will zeigen, was er kann: „Ganz unerwartet bekomme ich heute Nacht (...) einen höchst beunruhigenden Besuch von meiner seit vielen Jahren schon ganz abandonnierten Liebhaberin: der Gicht (Gonagra). Bekannt mit dem Gange dieser Krankheit, sah ich mit Schrecken die Unmöglichkeit der auf übermorgen angesetzten Reise.“ Weil dies ein Tagebuch ist, weiß der Autor tatsächlich nicht, ob er die seit Langem geplante Reise ins Weserbergland überhaupt antreten kann. Dies verleiht der Lektüre eine ganz eigene Spannung.
Was erfahren wir in diesem Tagebuch über das Jahr 1806? Ferdinand Beneke gewährt uns einen Blick in eine Zeit, in der Hinrichtungen und Duelle selbstverständlich waren, er erzählt von beschwerlichen Kutschenreisen und der Sorge um das Hinterland: am 9. Oktober erklärt Preußen Frankreich den Krieg. Beneke ist ein aufgeklärter Geist, doch zugleich kritisiert er die „kalte Vernunft“. Hier schreibt ein hellwacher Zeitgenosse. Selbst wenn es ums Wetter geht, ist der Text nicht banal: „Häßlich schneidende, trockne OstLuft mit SandPuder, und SpottSonnenSchein. (...) Kaum läßt seit gestern der Luftstrom aus Osten nach, so stehen schon an allen Seiten Gewitter umher, und es ist schwühl zum Ersticken. Verdammtes Klima!“
Dass man sich auch damals um das Klima sorgte, gehört zu den Überraschungen dieser Nachrichten aus dem Jahr 1806. Denn das Wort Klima kommt in diesem Text nicht von ungefähr: Astronomen wollten eine Veränderung der Sonnenflecken festgestellt haben, man befürchtete das Schlimmste.
„In mir stürmte es mächtig“
Im Zentrum dieses Jahres steht für Ferdinand Beneke jedoch etwas höchst Intimes: Eben hat der 32-Jährige noch befürchtet, er werde niemals heiraten – und schon verliebt er sich in die 17-jährige Karoline. Seine Liebesnöte notiert er im Tagebuch auf separaten Blättern. Wir werden Zeuge eines dramatischen Auf und Abs. Mit der Kontrolle über seine Gefühle verliert Beneke auch beinahe die Kontrolle über seine Worte:
„Karoline zieht sich von mir zurück. Mir fiel eine Decke von den Augen und ich sah … ihre Gestalt verschönert und geröthet in dem Widerscheine meiner Flamme!? Das fehlte noch. Nun bin ich entschloßen. Genug des Vorspiels! Schweigend begleitete ich sie zu Hause. Aber in mir stürmte es mächtig.“
Der jugendliche Überschwang des Teenagers gefällt ihm. Er verehrt Karoline geradezu schwärmerisch. Der Altersabstand scheint ihn nicht zu stören, obwohl es durchaus Irritationen gibt: „Ach! Die Liebe muß sich ja wol in ihrem bißher so kindlichen Herzen anders aussprechen, anders toben und erschüttern als in meinem, welches die Erfahrung und die Entwickelung des Mannes erweitert und stärker gemacht hat.“
Moderne Selbstbeobachtung, wie wir es von uns kennen
Ein Vollblut-Patriarch also, wie es seiner Zeit entsprach. Doch zugleich ist Ferdinand Beneke ein Mann der Gefühle. So befremdlich uns heute die unreflektierte Hierarchie der Geschlechter sein mag, so modern ist die Selbstbeobachtung, die er in seinem Tagebuch übt. Die „Achtsamkeit“, die wir heute neu zu entdecken meinen, scheint vor zweihundert Jahren selbstverständlich gewesen zu sein. Ohne jede Scheu gibt Ferdinand Beneke im Tagebuch Auskunft über sein Innenleben. Er leidet unter Stimmungsschwankungen, und er findet eindrückliche Bilder für einen Zustand, den man heute wohl als Depression bezeichnen würde: „Es war ein Mißton in meiner Seele, wie, wenn ein Orgelspieler aus Zerstreuung die Hand zu lange auf einer nicht mehr paßenden Taste liegen läßt.“
Drei Tage war er in Lübeck. Nach der Rückkehr notiert er: „Uebrigens den ganzen Tag in der mir nach jeder Reise eigenen höchst fatalen, widerlichen Stimmung zu Hause. Ich begreife diese Stimmung nicht, so viel ich auch darüber nachdenke.“
So gewinnen wir in diesen Tagebüchern nicht nur einen Einblick in das Jahr 1806, sondern auch in das widersprüchliche Bewusstsein eines Mannes, der sich Rechenschaft ablegt über sich selbst. (Sieglinde Geisel)
Drei Jahre später
1809 enden die Lehr-und Jugendjahre des Juristen und Schriftstellers Ferdinand Beneke. Er ist nun ein verheirateter Mann und stolzer Vater einer Tochter, die er über alles liebt. Einzig Friedrich Wilhelm von Braunschweig, genannt der schwarze Herzog, mit seinem Freikorps, dessen Aufstellung der Preußenkönig aus Furcht vor den Franzosen vergeblich zu verhindern sucht, und der österreichische Erzherzog Karl leisten den Truppen Napoleon Bonapartes noch Widerstand. In einer Koalition mit den Engländern hofft der Habsburger, den Okkupanten zu schlagen.
Die Kämpfe ziehen sich das ganze Jahr hin und lösen bei Ferdinand Beneke ein wildes Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung aus. Der Advokat nimmt als stolzer Bürger, für den der Glaube an Gott, die Liebe zum Vaterland, die Herrschaft des Rechts und der Freiheit die Maximen seines Handelns darstellen, regen Anteil an den politischen Entwicklungen in Deutschland. So wie es ihm Zeit und Kräfte erlauben, engagiert er sich sogar als Diplomat und als Schriftsteller.
Kein hanseatischer Kniefall vor Napoleon
Zwar bangt er mit dem österreichischen Heer, aber seine Hoffnungen richtet der kluge Advokat auf Preußen, nicht auf den König, sondern auf die preußischen Reformer. Den Festen des französischen Statthalters in Hamburg bleibt er als Patriot natürlich fern, auch den auf französische Anweisung pompös gefeierten Geburtstag Napoleon Bonapartes ignoriert er. Beneke weigert sich sogar, zu Ehren des Kaisers sein Haus zu illuminieren, obwohl es der Rat anordnet:
„Meine Grundsätze darüber sind sehr einfach. Was der Staat sich an politischer Heucheley erlauben darf (wenn auch das erlaubt seyn kann?) daß ist des Einzelnen unwürdig. Illumination soll die Freude des Bewohners über die gefeyerte Begebenheit und seine Hochachtung für den gefeyerten Menschen ausdrücken. Fehlt ihm diese Freude, und Hochachtung, tritt wohl gar Jammer, und Abscheu an ihre Stelle, so erlaubt er sich eine höchst unmännliche Heucheley, eine Kriecherey, eine Handlung, wie sie einst Tell verschmähte.“
Es ist faszinierend, miterleben zu können, wie die Nachrichten vom wechselnden Kriegsglück des Koalitionsheers gegen Napoleon in Hamburg eintreffen und mit welcher Spannung und Erregung sie aufgenommen werden. Deutlich wird aber auch, wie wichtig ihm der geistige Austausch mit seiner Frau ist, mit der er über das Geschäft, über Wissenschaft, Religion und Politik spricht. Sie sind einander ebenbürtig und genau das schätzt Beneke. Bildung, Urteilsfähigkeit und Verstand des Partners gehören für ihn zu einer guten Ehe, denn in der Gemahlin sieht er vor allem die Gefährtin.
Christusähnlicher Held
Als überragend und von höchstem Symbolwert gilt ihm die Tat des preußischen Husarenoffiziers Ferdinand von Schill, der seinem König den Gehorsam aufkündigt und mit seinem Freikorps die Franzosen in Bedrängnis bringt. Seit seiner Hilfe bei der Verteidigung Kolbergs 1807 gilt Ferdinand von Schill ohnehin als Held. Ja, Beneke nennt ihn sogar „christusähnlich“. Als die Nachricht von Schills Tod im Kampf Hamburg erreicht, trauert der Tagebuchschreiber um seinen Helden, doch sieht der nüchterne Politiker und Advokat im Tod des Patrioten zugleich die Möglichkeit einer großen Erzählung, die Deutschlands Befreiung und Einigung befördern könnte:
„Eins freut mich: er hat groß geendet, er ist nun für Deutschland gestorben, der Erste; sein Name und sein Blut werden Dich wecken, Germania! und das Bruderband schlingen um alle Deutsche; und aus Schills Tode wird einst das Leben eines grossen Volks erstehen.“
Hamburgs Todesurteil
Der selbstbewusste Bürger Ferdinand Beneke vermag weder ohne Familie, noch ohne freies Vaterland zu existieren, beides gehört für ihn wie der innere Sinn und die äußere Form zusammen. Nach der Niederlage der Österreicher und dem Tod Schills endet das Jahr 1810 für ihn mit einer großen Zumutung, die ein Leben gemäß seiner Überzeugungen in Frage stellt. Er nennt es den „Abgrund“. Hamburg wird dem französischen Kaiserreich einverleibt:
„So ist Hamburgs TodesUrteil ausgesprochen. Wir sollen aufhören, nicht bloß Hamburger zu seyn, sondern auch Deutsche. (...) Und je mehr ich darüber nachdenke, desto fester wird meine Ueberzeugung, dieser unnatürliche Zustand der Dinge werde von gar kurzer Dauer seyn. Ja, schon längst Hamburgischem wie allem Partikular und Lokalwesen entfremdet, gewinne ich dieser Katastrophe sogar eine gute Seite ab, sofern sie mithelfen kann, durch Einigung der abgestorbnen Teile in großen Maßen den Weg zu bahnen, auf welchem wir Deutsche endlich zu dem Ziele der Nazionalität gelangen. (...) Wie, wenn wir nun nie ohne fremde Gewalt dahin gekommen wären? (...) Wie, wenn diese nun in Frankreichs Gewalt zerdrückten todten Maßen einst zu teutschem Leben erständen, und dann in Bekämpfung fremder Despotie anfangs unwillkührlich – bald aber willkührlich, – eins würden? – Schöner Gedanke des Trostes!“
Das Tagebuch dokumentiert die Entstehung des liberalen Denkens in Deutschland. Dieser liberale und zivile Geist, der sich im Diarium Ferdinand Benekes sowohl im Politischen als auch im Privaten zeigt, wird Jahre später in die Paulskirche einziehen und die demokratische Tradition Deutschlands mitbegründen. (Klaus-Rüdiger Mai)